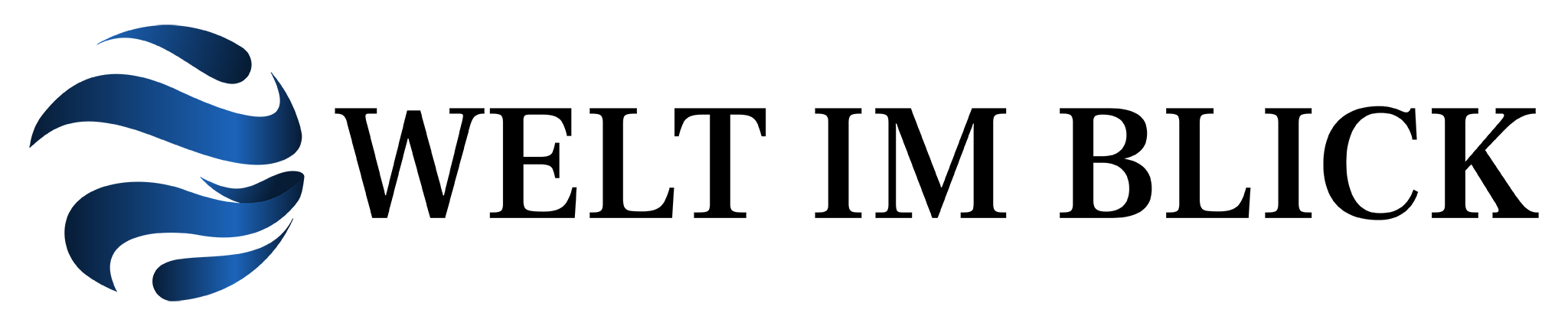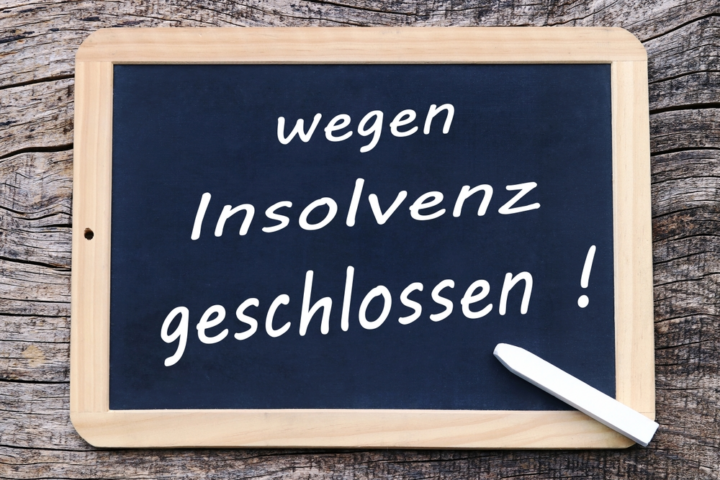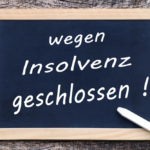Starker Ausgabenzuwachs im ersten Halbjahr 2025
Die Kosten für das Bürgergeld sind im ersten Halbjahr 2025 deutlich gestiegen. Nach aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit summierten sich die Zahlungsansprüche von Januar bis Juni 2025 auf rund 23,55 Milliarden Euro. Im Vergleich zum vorangegangenen Halbjahr, in dem die Summe noch bei 23,31 Milliarden Euro lag, ergibt sich damit ein Anstieg um rund 240 Millionen Euro.
Seit der Einführung des Bürgergelds im Jahr 2023 haben sich die Gesamtausgaben um mehr als 11 Prozent beziehungsweise 2,41 Milliarden Euro erhöht. Diese Dynamik übertrifft die erwarteten Einsparungen der geplanten Reform deutlich und wirft neue Fragen über die langfristige Finanzierbarkeit des Systems auf.
Reform mit geringer Sparwirkung
Die von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) geplante Reform des Bürgergelds, künftig als Grundsicherung bezeichnet, wird laut aktuellen Berechnungen kaum Entlastungen für den Bundeshaushalt bringen. Für das Jahr 2026 rechnet das Ministerium lediglich mit Einsparungen von rund 86 Millionen Euro. Dieser Betrag steht in starkem Kontrast zu den Mehrausgaben allein in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres.
Ursprünglich hatte die Union gemeinsam mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) deutlich höhere Erwartungen geweckt. In der politischen Diskussion war zeitweise von möglichen Einsparungen in Höhe von fünf Milliarden Euro jährlich die Rede. Die aktuelle Entwicklung zeigt jedoch, dass selbst bei einer Verschärfung der Zugangsregeln und strengeren Sanktionen das System kaum entlastet werden kann.
Ursachen für steigende Kosten
Die Gründe für den anhaltenden Kostenanstieg sind vielfältig. Einerseits stieg die Zahl der Leistungsbezieher, insbesondere durch den Zugang von Geflüchteten aus der Ukraine, die nach einer gewissen Aufenthaltsdauer Anspruch auf Bürgergeld haben. Andererseits belasten höhere Regelsätze, gestiegene Wohnkosten und Energiepreise den Bundeshaushalt zusätzlich.
Nach Schätzungen entfallen jährlich fast 50 Milliarden Euro auf die Finanzierung des Bürgergelds – eine Summe, die fast einem Achtel des gesamten Bundeshaushalts entspricht. Pro 100.000 Menschen, die das System verlassen, sinken die jährlichen Zahlungen um etwa eine Milliarde Euro. Gleichzeitig bleibt unklar, ob geplante Sanktionsverschärfungen oder Reformen wie die Einführung von Jugendberufsagenturen tatsächlich strukturelle Entlastung bringen.
Politische Reaktionen und Kontroversen
In der politischen Debatte spitzen sich die Gegensätze weiter zu. Vertreter der Union kritisieren die Reform als „unambitioniert“ und werfen der Bundesregierung vor, die Fehlanreize des bisherigen Systems nicht zu beseitigen. Aus Reihen der SPD und der Grünen wird dagegen betont, dass das Bürgergeld ein „menschenwürdiges Existenzminimum“ sicherstellen müsse.
Befürworter verweisen darauf, dass viele Leistungsempfänger wegen niedriger Löhne oder fehlender Vollzeitstellen dauerhaft auf Unterstützung angewiesen seien. Die Opposition hingegen fordert strengere Mitwirkungspflichten, Kürzungen bei Verstößen und eine deutliche Fokussierung auf Arbeitsmarktintegration.
Bürgergeld bleibt ein finanzieller Balanceakt
Ob die Bundesregierung die wachsenden Ausgaben langfristig unter Kontrolle bringen kann, bleibt offen. Experten der Bundesagentur für Arbeit gehen davon aus, dass die Reform allenfalls geringfügige strukturelle Entlastungen bewirken wird. Der Trend steigender Kosten dürfte sich daher fortsetzen – insbesondere, wenn wirtschaftliche Unsicherheit, Migration und steigende Lebenshaltungskosten weiterhin Druck auf den Arbeitsmarkt ausüben.
Das Bürgergeld bleibt damit ein zentraler Prüfstein für die Sozialpolitik der kommenden Jahre. Zwischen sozialer Absicherung und finanzieller Tragfähigkeit gilt es, eine Balance zu finden, die sowohl dem Anspruch des Sozialstaats als auch den Grenzen des Bundeshaushalts gerecht wird.